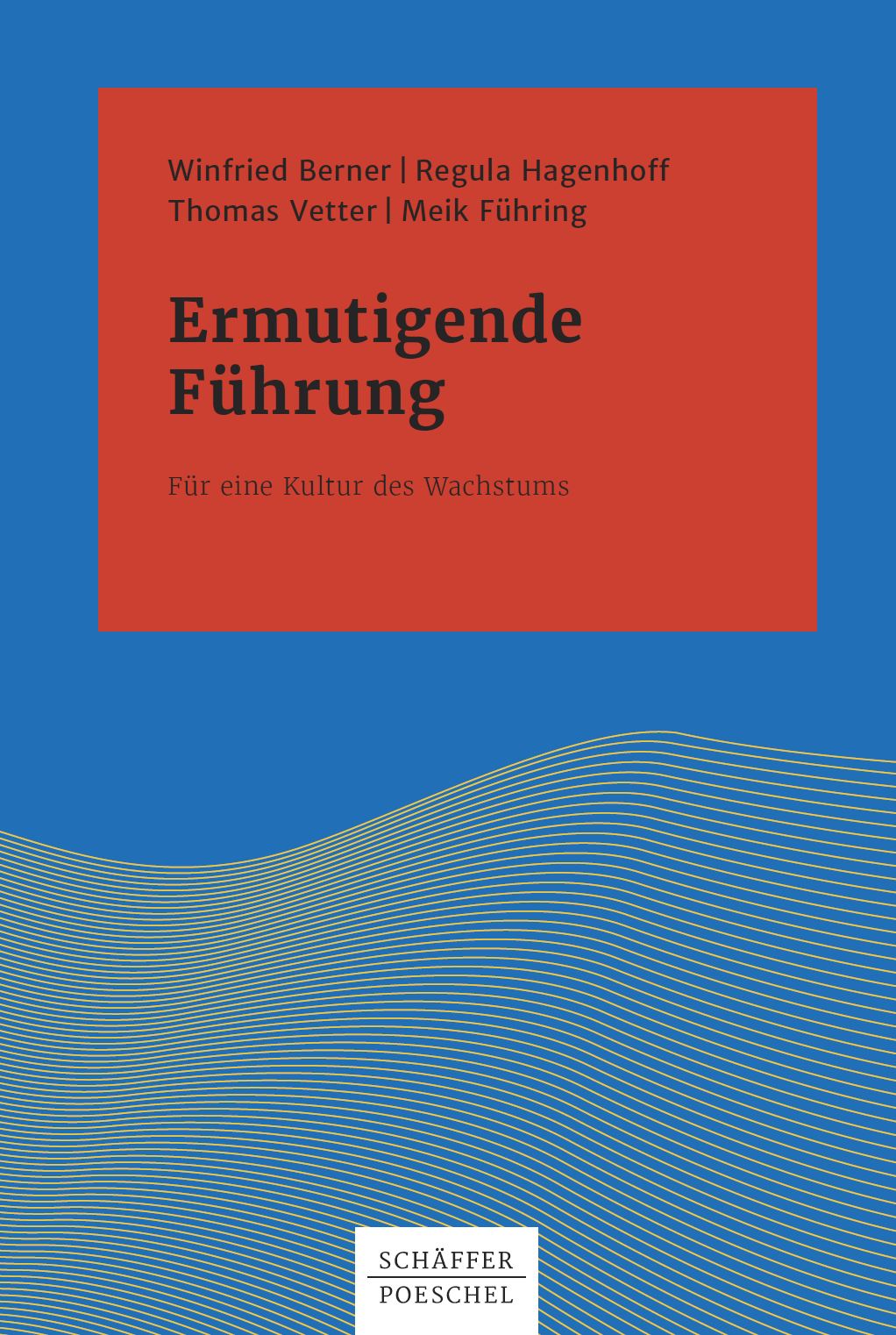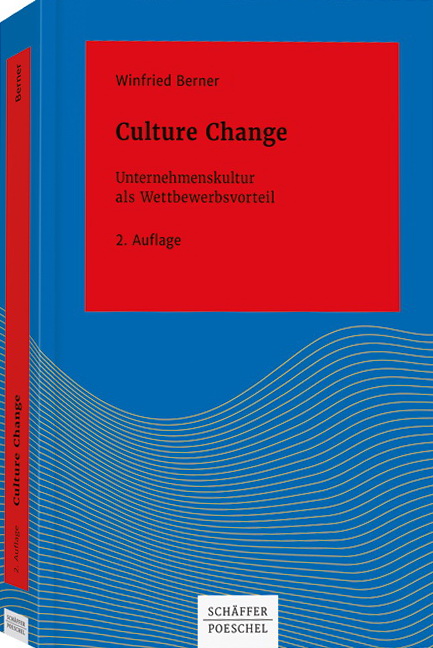Psychologie der Veränderung
|
||||||||||||||||
Individualpsychologie: Eine ganzheitliche Psychologie sozialer Beziehungen |
||
|
Der Begriff "Individualpsychologie" legt die Vermutung nahe, diese tiefenpsychologische Schule befasse sich vor allem mit dem Individuum, also mit dem Menschen als Einzelperson. Nichts könnte falscher sein: Von allen tiefenpsychologischen Schulen ist die Individualpsychologie diejenige, die den Menschen am stärksten als soziales Wesen begreift und sein gesamtes Denken, Fühlen und Handeln aus seinen sozialen Bezügen zu verstehen sucht. Aber warum nennt sie sich dann Individualpsychologie? Weil sie die Ganzheitlichkeit und Unteilbarkeit der Persönlichkeit betont – im Gegensatz etwa zur Psychoanalyse, die das menschliche Fühlen und Handeln als einen Kampf verschiedener "Instanzen" der Persönlichkeit erklärt. "Dividere" ist das lateinische Wort für teilen; In-dividual-psychologie steht somit für eine Psychologie der unteilbaren Persönlichkeit. Aber so richtig selbsterklärend ist die Namensgebung trotzdem nicht. |
|
|
|
Die starke Betonung der Unteilbarkeit der Persönlichkeit hat ihren historischen Grund darin, dass die Individualpsychologie in Abgrenzung zur Psychoanalyse entstand. Sigmund Freud (1856 – 1939), der Ahnherr der Psychoanalyse, erklärte das Handeln des Menschen und seine oft widersprüchlichen Gefühle damit, dass innerhalb seiner Persönlichkeit unterschiedliche Instanzen im Widerstreit lägen: Da gebe es einerseits das impulsive "Es", die Instanz der Triebe, Wünsche und Impulsregungen, andererseits das gestrenge "Über-Ich", die Instanz der Werte, Normen und der Kontrolle. Als vermittelnde Instanz dazwischen stehe das "Ich", das irgendwie einen akzeptablen Ausgleich von "Es" und "Über-Ich" hinbekommen müsse. Der Wiener Arzt Alfred Adler (1870 – 1937), bis dahin ein engagiertes Mitglied von Freuds "Psychoanalytischer Vereinigung", stellte der Theorie des Meisters um 1910 eine robuste These entgegen. Der vermeintliche Kampf zwischen Es und Über-Ich sei nur Theater, eine dramatische Inszenierung, mit der die Menschen sich selbst und ihrer Umgebung Sand über ihre wahren Absichten in die Augen streuten. Nach seiner Auffassung war der Mensch eine unteilbare Ganzheit; den vermeintlichen Kampf der Persönlichkeitsinstanzen gebe es nicht; der wahre Willen eines Menschen komme allein in seinen Handlungen zum Ausdruck; alles Übrige sei letztlich ohne Bedeutung. Diese und einige andere Ketzereien brachten Adler letztlich den Hinauswurf aus Freuds Psychoanalytischer Vereinigung ein – und der Nachwelt die Bezeichnung Individualpsychologie für Alfred Adlers tiefenpsychologische Schule. |
|
|
Unterschiedliche Erklärungsmodelle für menschliches Verhalten |
||
|
Diese historische Kontroverse ist wichtiger als sie scheinen mag, auch heute noch. Denn die wichtigste Aufgabe einer jeden Psychologie besteht ja darin, zu erklären, weshalb Menschen so handeln, wie sie handeln– und warum sie zuweilen auch seltsame, unverantwortliche und selbstschädigende Dinge tun. Was sind zum Beispiel die Gründe, wenn ein Mensch gewalttätig ist? Die Psychoanalyse bietet hier zwei mögliche Erklärungsansätze an: Entweder ist bei diesem Menschen das "Über-Ich" nicht ausreichend entwickelt ist, sodass er die entsprechenden Normen nicht ausreichend verinnerlicht ("internalisiert") hat. Oder sein "Ich" ist zu schwach, um die gewalttätigen Impulse aus dem "Es" zu kontrollieren. Adler hingegen würde trocken konstatieren, der Grund für die Gewalttätgkeit sei, dass sich der Betreffende in der gegebenen Situation für die Anwendung von Gewalt entschieden habe. Und zwar deshalb, weil er sich davon am ehesten das Erreichen seiner Ziele verspricht. Statt über psychische Instanzen zu spekulieren, konzentriert sich die Individualpsychologie auf die Frage, welche Ziele und Absichten die betreffende Person mit der Gewaltanwendung verfolgt. Das heißt, sie sucht die Suche die Erklärung des Verhaltens nicht in der Vorgeschichte, sie sucht es in den Intentionen, der "Finalität" der handelnden Person. |
|
|
|
Mit ihrer Suche nach in der Lebensgeschichte liegenden Erklärungen tendiert die Psychoanalyse dazu, Fehlverhalten zu entschuldigen: Wenn "das Über-Ich nicht ausreichend entwickelt ist" oder "das Ich zu schwach für die Beherrschung der gewalttätigen Impulse" war, dann kann die handelnde Person ja nichts dafür: Sie ist unkontrollierbaren Kräfte zum Opfer gefallen und damit frei von eigenem Verschulden. Ihr ist halt "die Sicherung durchgebrannt" oder "die Faust ausgerutscht" – bedauerlich ohne Zweifel, vor allem für den, der sie ins Gesicht bekommen hat, aber letztlich kaum zu verhindern, außer vielleicht durch eine langwierige psychotherapeutische Behandlung, die der Stärkung von "Ich" und "Über-Ich" dient. Die Individualpsychologie hingegen lässt die Verantwortung bei der handelnden Person: Nicht die Faust hat sich von alleine in Bewegung, sondern der Mensch am anderen Ende des Arms hat sich – und sei es in einem spontanen Wutausbruch – entschieden, sie dem Gegenüber ins Gesicht zu schlagen. Und dafür ist er auch verantwortlich. Das macht die Individualpsychologie wesentlich "handfester", aber auch unbequemer als andere psychologische Schulen. Zugleich lässt sie dem Menschen aber seine Würde, weil sie ihn nicht als Spielball unkontrollierbarer Triebe und Affekte darstellt, sondern als verantwortlich entscheidendes und handelndes Wesen. |
|
|
|
Welche der beiden Sichtweisen richtig(er) ist, ist wissenschaftlich nicht entscheidbar. Es gibt keine Versuchsanordnung, mit dem man herausfinden könnte, ob unsere Persönlichkeit tatsächlich aus unterschiedlichen Instanzen besteht. (Es ist sogar ziemlich schwierig anzugeben, was diese Aussage überhaupt bedeutet.) Ebensowenig lässt sich empirisch klären, ob und in welchem Umfang wir tatsächlich verantwortliche Gestalter unseres Handelns sind. Zwar hat die Gehirnforschung herausgefunden, dass an der Handlungssteuerung tatsächlich unterschiedliche Gehirnregionen beteiligt sind – und manche möchten darin gern eine Bestätigung von Freuds Instanzenmodell sehen. Doch in Wahrheit zeigt es nur, dass an dieser Aktivität – wie an den meisten anderen auch – mehrere Hirnregionen beteiligt sind, die – wiederum in Adlerianischer Sicht – zu einer ganzheitlichen Entscheidung zusammengeführt und in ein "unteilbares" Handeln umgesetzt werden. (Aus der Anzahl der beteiligten Gehirnregionen lässt sich nicht viel ableiten. So sind am Musikerleben nach neuester Forschung sogar sechs Gehirnregionen beteiligt; trotzdem käme niemand auf die Idee, hier ein wildes Ringen sechs widerstreitender psychischer Instanzen hineinzuinterpretieren.) Doch auch Adlers Postulat des verantwortlichen Entscheidens lässt sich nicht empirisch belegen, denn "Verantwortlichkeit" ist keine empirische Kategorie, sondern eine philosophisch-ethische. Sowohl die Psychoanalyse als auch die Individualpsychologie sind keine empirischen Fakten, sondern Denkmodelle, hinter denen letztlich unterschiedliche Welt- und Menschenbilder stehen. Im Prinzip kann hier jeder das Modell wählen, mit dem er am meisten anfangen kann. Aus meiner Sicht gibt die Individualpsychologie dafür mit weitem Abstand am meisten her. Aber das ist meine Wahl, keine objektive Wahrheit. |
|
|
|
Das mag man unbefriedigend finden; es ergibt sich aber unvermeidlich aus dem Forschungsansatz der tiefenpsychologischen Schulen. Sie streben allesamt an, aus der klinischen und pädagogischen Praxis (leider nur selten auch aus der beruflichen) eine umfassende Theorie menschlichen Verhaltens abzuleiten. Ganz anders die ebenfalls Ende des 19. Jahrhunderts begründete naturwissenschaftlich-experimentelle Psychologie: Sie zielte ausschließlich auf experimentell gesicherte Aussagen, musste dafür aber in Kauf nehmen, keine ganzheitliche Theorie der menschlichen Psyche entwickeln zu können, sondern nur relativ kleinteilige Aussagen zu einzelnen Teilaspekten des menschlichen Denkens und Handelns zu machen – die sogenannten "Theorien mittlerer Reichweite" (oder "middle-range theories"). Mittlerweile nähern sich die naturwissenschaftliche Psychologie und die Tiefenpsychologie an manchen Stellen an, etwa bei der Erklärung der Wahrnehmung oder der Emotionen. Und in vielen Fällen hat Adlers Individualpsychologie wichtige Erkenntnisse der naturwissenschaftlich-experimentellen Psychologie vorweggenommen. |
|
|
Der Mensch: Ein aktiv handelndes, Entscheidungen treffendes Wesen |
||
|
Doch wichtig ist nicht nur, wie schlüssig das Erklärungsmodell ist, das eine psychologische Schule anbietet, wichtig ist auch, wie es danach weitergeht: Ob sie also, ausgehend von ihrem jeweiligen Modell, zu praktikablen und nützlichen Handlungsempfehlungen kommt. Denn für den Praktiker, gleich ob als Erzieher oder Therapeut, als Coach oder als Manager, zählt nicht allein der "Wahrheitsgehalt" eines psychologischen Modells; noch mehr zählt dessen Nützlichkeit und Praxistauglichkeit: Hilft es uns, nicht nur schlüssige Erklärungen für unsere Beobachtungen zu finden, sondern vor allem praktikable und umsetzbare Lösungsansätze? Die Individualpsychologie hat hier viele nützliche Gedanken und Konzepte zu bieten, sodass sie sich nicht nur als Denkmodell für den privaten Lebensbereich anbietet, sondern auch und gerade für Abläufe und Veränderungsprozesse in Organisationen. |
|
|
|
Das Herangehen der Individualpsychologie ist dabei so zupackend, dass es Ungeübten zuweilen den Atem verschlägt: Sie bestreitet zwar nicht, dass wir zuweilen zwischen konkurrierenden Zielen hin- und hergerissen sind, wie etwa zwischen dem Wunsch abzunehmen und der Lust auf eine Sahnetorte. Aber sie schließt kategorisch aus, dass wir anders handeln als wir es wollen. Wenn wir also wieder mal den Verlockungen der Sahnetorte erliegen, dann nicht etwa, weil tief in uns ein Sahnetortentrieb existiert, der mächtiger ist als unser Wille, sondern weil wir selbst uns in der Stunde der Versuchung entschieden haben, dem kurzfristigen Tortenvergnügen Vorrang vor unserer langfristigen Schlankheitsideal zu geben. Es kann schon sein, dass wir uns nach dem Verspeisen der Torte plötzlich und unerwartet wieder an unseren Wunsch abzunehmen erinnern und dann mit vollem Herzen (und vollem Magen) bedauern, den Verlockungen der Torte nachgegeben zu haben. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir uns in der akuten Situation für die Torte und damit gegen das Abnehmen entschieden haben. Hier waren keine finsteren Mächte am Werk, die uns die Kontrolle über unser Verhalten entrissen haben: Es war niemand anders als wir selbst, der sich entschieden hat, im entscheidenden Moment zur Kuchengabel zu greifen. |
|
|
Unser schlechtes Gewissen nach dem "Sündenfall" beeindruckt Individualpsychologen wenig: Sie deuten es unbarmherzig als den Versuch, uns selbst und der Umgebung weiszumachen, dass wir "eigentlich" ganz andere, weitaus edlere Absichten gehabt hätten und nur durch eine Verkettung unglücklicher Umstände (oder die subtilen Konsumzwänge des Spätkapitalismus) zum unschuldigen Opfer der heimtückischen Sahnetorte geworden sind. Niemand hat das besser auf den Punkt gebracht als der Individualpsychologe Rudolf Dreikurs (1897 - 1972), ein Schüler Alfred Adlers: "Ein schlechtes Gewissen ist Ausdruck von guten Absichten, die man nicht hat." Indem sie solche nachträglichen Schuldgefühle und Selbstbeschimpfungen als Ausreden und Alibis entlarvt, ist die Individualpsychologie zuweilen ausgesprochen lästig, doch hat sie den großen Vorteil, dass sie uns nicht nur die Verschwendung unserer Zeit mit eigenen und fremden Ausreden erspart, sondern auch die Selbstvorwürfe und Minderwertigkeitsgefühle wegen unserer vermeintlichen Willensschwäche. Wenn wir anerkennen, dass niemand anders als wir selbst sich so entschieden hat, wie wir uns entschieden haben, gewinnen wir die Freiheit, uns im Angesicht der nächsten Versuchung anders zu entscheiden – oder wieder genauso. Große Ankündigungen und Selbstverpflichtungen sind dabei entbehrlich: Aus individualpsychologischer Sicht zeigt sich allein aus unseren Taten, wie wir uns wirklich entschieden haben – das heißt aus unserem Verhalten gegenüber der nächsten Sahnetorte, die auf unerklärliche Weise unseren Weg kreuzt. Mit diesem robusten Pragmatismus erspart die Individualpsychologie uns Zeit und nutzlose Selbstquälerei – und sie schafft Klarheit. |
|
|
Eine Psychologie der sozialen Beziehungen |
||
Doch nicht der heldenhafte Kampf gegen Sahnetorten und andere Widrigkeiten des Lebens steht im Mittelpunkt der Individualpsychologie, sondern die Beziehungen des Menschen zu seinen Mitmenschen. Adler baute sein gesamtes Gedankengebäude auf eine ebenso alte wie grundlegende Erkenntnis auf, nämlich, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Klar, diese Einsicht wurde in der Geistesgeschichte schon lange vor Adler unzählige Male formuliert, doch erst Adler erkannte, dass die Eigenschaft des Menschen, ein soziales Wesen zu sein, eben nicht bloß ein Merkmal unter anderen ist, sondern der Dreh- und Angelpunkt seiner Existenz. Und dass er damit zwangsläufig auch der Dreh- und Angelpunkt der Psychologie sein muss. Konsequenterweise baute er seine gesamte Lehre auf dieses Fundament auf. |
||
Tatsächlich ist der Mensch auf andere Menschen fast in gleicher Weise angewiesen wie ein Fisch auf das Wasser. Zwar können wir deutlich länger als wasserlose Fische ohne andere Menschen (über)leben, doch ohne die Beziehung zu anderen Menschen verliert unser Leben seine Verankerung. Unser gesamtes Denken, Fühlen und Handeln spielt sich letztlich in sozialen Bezügen ab. So haben unsere Gefühle fast immer einen Bezug zu anderen Menschen, und das Gleiche gilt auch die Gedanken, welche diese Gefühle auslösen. Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass sogar der Kampf gegen Sahnetorten in einem sozialen Bezug steht. Denn wozu, also zu welchem Zweck wollen wir eigentlich abnehmen? Nicht zuletzt doch wohl deshalb, weil wir meinen, dass wir dann "besser aussähen", also uns selbst und anderen Menschen besser gefielen. Aber selbst wenn für uns nicht soziale, sondern gesundheitliche Gründe im Vordergrund stehen, ist unser dahinter stehendes Zielbild vermutlich nicht ein langes und gesundes Leben als Eremit, sondern ein Leben in der Gemeinschaft mit den Menschen, mit denen wir uns verbunden fühlen. |
||
Eine zentrale Frage für jeden Menschen, ja die zentrale Frage überhaupt, ist die nach seiner Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft und nach seinem Platz in dieser Gemeinschaft. Wohl jeder Mensch kennt das Gefühl, "einsam und verloren" zu sein, also keine Gemeinschaft zu haben, zu der man gehört. Und wohl jeder kennt auch die Erfahrung, sich in einer Gruppe nicht akzeptiert und zugehörig zu fühlen. Und er weiß, dass er in solchen Situationen nur ein Schatten seiner selbst ist. Wir sind dann gehemmt und angespannt bis zur Verkrampfung, wollen besonders gut sein und haben zugleich Angst, etwas falsch zu machen oder durch ein falsches Wort noch mehr Ablehnung auf uns zu ziehen. Selbst unser Gehirn scheint in solchen Situationen nicht mehr richtig zu funktionieren. Wie der Individualpsychologe Theo Schoenaker in umfangreichen Befragungen herausgefunden hat, sagen viele Menschen, dass sie sich in solchen Situationen nicht nur – im doppelten Sinn des Wortes – schlecht fühlen, sondern auch dumm! Dagegen blühen wir auf, wenn wir uns zugehörig, akzeptiert und geschätzt fühlen. Dann geht es uns gut, wir sind entspannt, kommunikativ, ideenreich und klar in unseren Aussagen. |
|
|
Schlüsselrolle des Zugehörigkeitsgefühls |
||
Offenbar ist es nicht nur für unsere Befindlichkeit wichtig, ob wir uns akzeptiert und zugehörig fühlen, sondern auch für unsere Leistungsfähigkeit. Wie zahlreiche Untersuchungen aus der Pädagogischen Psychologie übereinstimmend feststellen, variiert die Leistung von Schülern zum Teil um mehrere Notenstufen, je nachdem, ob ihnen der Lehrer und ihre Mitschüler etwas zutrauen oder ob sie sie für Versager halten und nur auf den nächsten Fehler warten. Vieles spricht dafür, dass Ähnliches auch im beruflichen Umfeld gilt: Eine Mitarbeiterin, der von Vorgesetzten und Kollegen als Leistungsträgerin betrachtet und behandelt wird, wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur besser fühlen, sondern auch real höhere Leistungen bringen als ein Kollege, der als unfähig und/oder als "nicht mehr motivierbar" gilt. |
||
Beides sind sich verstärkende Spiralen. Wer spürt, dass seine Leistung geschätzt wird, freut sich darüber und ist dadurch noch stärker motiviert, gute Beiträge zu bringen. Das soziale Umfeld wiederum achtet und ermutigt vor allem Menschen, die einen wertvollen Beitrag zum Gesamterfolg leisten. Wer dagegen das Gefühl hat, dass seine Beiträge ohnehin nicht geschätzt werden, sieht auch wenig Grund, sich anzustrengen, geschweige denn, freiwillig mehr zu tun als er muss. Was wiederum ein negatives soziales Echo auslöst: Wer wenig beiträgt, sinkt in der Wertschätzung der Gruppe, bis er schließlich in die Rolle des ungeliebten, nur widerwillig mitgeschleppten und möglicherweise "gemobbten" Außenseiters abrutscht. |
||
Es liegt nicht nur im Interesse jedes Einzelnen, sondern auch im Interesse jeder Gruppe und ihres Leiters, dafür zu sorgen, dass nicht die Negativspirale von Ablehnung, Entmutigung und Resignation in Gang kommt, sondern die Positivspirale von Zugehörigkeit, Ermutigung und Leistung. Bei Menschen, die von sich aus genügend sozialen Mut mitbringen, muss man dafür nicht viel tun; da reicht es, dem Entstehen dieser Positivspirale nicht im Weg zu stehen – und auch nicht zuzulassen, dass andere sie etwa durch Ausgrenzung sabotieren. Bei anderen, weniger selbstsicheren Menschen tut man gut daran, das Gefühl der Zugehörigkeit aktiv zu fördern. Der "Trick" besteht hier darin, zum einen durch ein wohlwollendes Teamklima ("indirekte Ermutigung"), zum anderen durch gezielte Ermutigung des Einzelnen dafür zu sorgen, dass sich möglichst alle Teammitglieder geschätzt und zugehörig fühlen. Dann sind die Betreffenden auch motiviert, ihren Beitrag zum Teamerfolg zu leisten. Denn wenn sie sich zugehörig fühlen, tun Menschen nicht nur das, wofür sie rein formal zuständig sind, sondern sie "gehen die Extrameile" und tun auch das, was von der Sache her notwendig ist. Dieses Gefühl der Mitverantwortung für die Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, nennt die Individualpsychologie das "Gemeinschaftsgefühl". |
||
Dass sich alle Mitglieder einer Gruppe akzeptiert und zugehörig fühlen, ist kein idealistischer Wunschtraum; es ist erreichbar, sowohl theoretisch als auch praktisch. Denn es gibt hier keine Konkurrenzsituation in dem Sinne, dass sich in einer Gruppe auf keinen Fall alle zugehörig fühlen könnten. Entgegen manchen gruppendynamischen Legenden muss es keineswegs in jeder Gruppe ein "Omega", also einen Außenseiter geben; vielmehr können ohne Weiteres alle Teammitglieder dazugehören und sich dementsprechend auch akzeptiert und zugehörig fühlen. Und das sollte jedes Team und jede Leiterin, gleich auf welcher Ebene, auch mit allem Nachdruck anstreben, zumal das Entstehen eines Gemeinschaftsgefühls nicht nur für das Teamklima wichtig ist, sondern auch für die Leistungsfähigkeit der Gruppe insgesamt. Nnur wenn jedes einzelne Teammitglied nicht nur tut, was es muss, sondern beiträgt, was von der Sache her erforderlich ist, kommt in Summe ein optimales Ergebnis zustande. |
||
Weshalb das Zugehörigkeitsgefühl so elementar ist |
||
Eine interessante Frage ist, weshalb das Zugehörigkeitsgefühl eigentlich eine so zentrale Bedeutung für unsere Befindlichkeit, unsere Leistung und unsere Verhalten hat. Wie kommt es, dass Menschen bereit sind, im Grunde alles zu tun, um bei den Gruppen, die ihnen wichtig sind, dazuzugehören? Schon Kinder und Jugendliche legen ja größten Wert auf bestimmte Kleidung, um in ihrer Gruppe keine Außenseiter zu sein; viele beginnen zu trinken und zu rauchen, um dazuzugehören, manche nehmen Drogen, oder grenzen sich aggressiv gegen andere Gruppen ab.
|
||
Nicht nur beim Militär tun junge Männer alles, um nicht als "Feigling" oder "Kameradenschwein" ausgegrenzt zu werden. Auch in Politik und Geschäftswelt kommen nicht nur Spitzenleistungen, sondern auch schockierende Fehlleistungen durch "Group-Think" zustande, also letztlich dadurch, dass selbst reife, erwachsene Menschen im Positiven wie im Negativen beinahe alles mitmachen, um ihre Akzeptanz in der jeweiligen Gruppe nicht zu gefährden. |
||
Die Erklärung hierfür dürfte sein, dass die Zugehörigkeit für Menschen in früheren Jahrtausenden eine Frage des Überlebens war. In der Zeit der Jäger und Sammler, dem weit überwiegenden Teil der Menschheitsgeschichte, hatten Menschen nicht die geringste Chance, als Einzelgänger zu überleben, geschweige denn, ihren Nachwuchs durchzubringen. Sie waren existenziell darauf angewiesen, zu ihrer jeweiligen Horde oder Stammesgesellschaft dazuzugehören; sie hatten ja nicht die Möglichkeit, sich im Falle einer "Verstoßung" einfach eine andere Horde oder einen anderen Stamm zu suchen, so wie man heute die Firma wechselt. Auch Ackerbauern und Viehzüchter waren auf die Akzeptanz in ihrem Dorf oder Clan buchstäblich "alternativlos" angewiesen. |
||
Es ist daher wahrscheinlich, dass sich das Streben nach Zugehörigkeit im Laufe der Evolution als Überlebensmechanismus herausgebildet und genetisch verankert hat: Für die Chance, die eigenen Gene an nachfolgende Generationen weiterzugeben, war es vorteilhaft, der Frage nach der eigenen Zugehörigkeit größte Aufmerksamkeit zu widmen. Deshalb setzen uns schon die geringste Warnsignale unter massiven Stress und motivieren uns, alles zu tun, um seine Akzeptanz in der Gruppe zu sichern. Aufgrund dieses Erbes aus der Menschheitsgeschichte ist das Gefühl, nicht dazuzugehören und ausgegrenzt oder "gemobbt" zu werden, auch heute noch so belastend. |
|
|
Minderwertigkeitsgefühle und Kompensation |
||
Wie entsteht Zugehörigkeit? Ein neugeborenes Kind gehört einfach kraft seiner Geburt zu der Gemeinschaft, in die es hineingeboren wurde: zu seinen Eltern, in früheren Zeiten zu seinem Clan und seinem Stamm, heute zu seiner Familie, seiner Gemeinde, seiner Nation und der Weltgemeinschaft. Subjektiv sieht das aber oft völlig anders aus. Das "Zugehörigkeitsgefühl" ist daher nicht bloß ein Abbild der objektiven Zugehörigkeit. Schon kleine Kinder können das Gefühl haben, nicht dazuzugehören, sondern irgendwie unerwünscht und ausgeschlossen zu sein – sowohl in der Familie als auch im Kindergarten und auf dem Spielplatz. Das löst beinahe zwangsläufig die Angst aus: Irgendetwas scheint mit mir nicht in Ordnung zu sein, sodass ich nicht genauso akzeptiert bin und nicht dazu gehöre wie die anderen. So, wie ich bin, bin ich offensichtlich nicht gut genug. Dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, nannte Adler das Minderwertigkeitsgefühl. (Wichtig ist, zu sehen, dass es sich hier "nur" um ein Gefühl handelt, nicht um eine objektive Tatsache. Es geht also gerade nicht um tatsächliche Minderwertigkeit, sondern allein darum, dass sich jemand minderwertig fühlt.) |
|
|
Da das Bedürfnis nach Zugehörigkeit aber tief in allen Menschen steckt, ergibt sich aus dem Gefühl, nicht akzeptiert zu sein, die drängende Frage: Was muss ich tun, um doch dazuzugehören? Wie machen es denn die anderen, dass sie dies scheinbar so mühelos schaffen und so selbstverständlich dazugehören? Gleich ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, wir Menschen versuchen alles, um einen Platz in der Gemeinschaft zu erringen, an dem sie anerkannt und als Mitglieder der Gruppe respektiert sind. Um das zu erreichen, bemühen sie sich, ihre vermeintliche Minderwertigkeit zu kompensieren, indem sie sie sich besonders anstrengen und es besonders gut machen wollen: Kinder versuchen zum Beispiel, besonders brav zu sein, Schüler, besonders gute Leistungen zu erbringen, damit die Eltern mit ihnen zufrieden sind und sie lieb haben. Dieses aktive Bemühen behalten sie so lange bei, wie sie sich zutrauen, ihr Ziel der Zugehörigkeit durch Anstrengung oder Wohlverhalten erreichen zu können. Wenn sie der Mut verlässt, geben sie zwar nicht das Ziel der Zugehörigkeit auf, ändern aber die Strategie, wie sie es zu erreichen versuchen. Beispielsweise stören sie dann, um Aufmerksamkeit zu erzwingen, legen sich quer, um beachtet zu werden, oder verwickeln ihre Umgebung in Machtkämpfe, so nach dem Motto: "Lieber eine Tracht Prügel als überhaupt keine menschliche Zuwendung!" |
||
Je ausgeprägter die Minderwertigkeitsgefühle, desto heftiger sind nach Adler die Anstrengungen, sie zu kompensieren. Wir schießen dabei in aller Regel übers Ziel hinaus: Wir versuchen nicht nur, unsere tatsächlichen oder vermeintlichen Mängel auszugleichen, sondern neigen zur Überkompensation. Das muss nicht immer schlecht sein: Adlers vielzitiertes Beispiel ist das von dem berühmten griechischen Redner Demosthenes, von dem es heißt, dass er als Kind gestottert habe, sich aber mit eiserner Disziplin im Reden trainiert habe, indem er mit Kieselsteinen im Mund am Meer gegen die Brandung angeschrien habe. Auf diese Weise kompensierte er nicht nur seine, wie Adler dies nannte, "Organminderwertigkeit" und lernte, normal zu sprechen. Vielmehr entwickelte er sich "vor lauter Überkompensation" zu einem gefragten Redner. Tatsächlich lassen sich in den Biographien vieler berühmter Persönlichkeiten Beispiele für erfolgreiche Überkompensation finden. Und vermutlich fänden sich solche Beispiele in noch größerer Zahl in den Lebenswegen von Menschen, die nicht so berühmt geworden sind, aber ebenfalls ihren Weg gemacht haben. (Über)Kompensation bezieht sich keineswegs nur auf organische Schwächen. Beispielsweise findet man unter erfolgreichen Verkäufern viele, die aus einfachen, wenn nicht ärmlichen Verhältnissen kommen. Ihre Entschlossenheit, sich mit harter Arbeit nach oben zu arbeiten, verleiht ihnen mehr Energie als sie die Mehrzahl derjenigen besitzen, die in behüteten Verhältnissen und relativem Wohlstand aufgewachsen sind. |
|
|
Die Kompensation und Überkompensation empfundener Minderwertigkeit ist also vom Grundsatz her nichts Neurotisches oder gar Krankhaftes. Nach Adler ist es vielmehr ein Grundmuster unseres Seelenlebens und eine wichtige Energiequelle unseres Handelns – was auch aus evolutionsbiologischer Sicht schlüssig ist, weil die Fähigkeit des Organismus', wahrgenommene Schwächen auszugleichen, einen erheblichen Nutzen für die "Fitness" des Einzelnen sowie für seine Chance hat, fortpflanzungsfähige Nachkommen aufzuziehen. Auch das "Streben nach Vollkommenheit", das Adler als zentrales Motiv des Menschen sieht, speist sich letztlich aus der Einsicht in die eigene Unvollkommenheit. (Wenn wir heute Professionalität als sehr anstrebenswert ansehen, ist oft etwas ganz Ähnliches gemeint.) Zum Problem werden Minderwertigkeitsgefühle zum einen dann, wenn sie so erdrückend sind, dass Menschen an sich selbst verzweifeln, weil sie ständig von dem Gefühl (bzw. dem Gedanken) gepeinigt werden, nicht gut genug zu sein. Dann können sich die Minderwertigkeitsgefühle, die jeder Mensch von Zeit zu Zeit empfindet, zu einen "Minderwertigkeitskomplex" auswachsen. Zum Problem werden sie zweitens dann, wenn die überkompensatorische Energie zur Belastung für die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit wird – was etwa dann der Fall ist, wenn Führungskräfte tief in ihrem Inneren glauben, dass sie nur dann etwas wert sind, wenn sie absolut fehlerlos und perfekt sind, und daher keine Fehler zuzugeben bereit sind. |
||
Streben nach Geltung und einer akzeptierten Position |
||
|
Doch wir wollen nicht bloß "irgendwie" dazugehören, sondern wir möchten einen möglichst guten, angesehenen Platz in den Gruppen einnehmen, denen wir angehören. Adler nannte dies das "Streben nach Geltung". Das ist schon schwieriger zu bewerkstelligen als die schiere Zugehörigkeit, denn hier können Konkurrenzsituationen und Konflikte auftreten – und in der Realität tun sie es auch häufig. Zwar ist es glücklicherweise nicht so, dass alle Menschen dieselben Vorstellungen davon haben, was ein "guter und angemessener Platz" für sie ist. Trotzdem können sie sich ins Gehege kommen – etwa dann, wenn zwei oder mehr Teammitglieder die Führungsrolle anstreben. Auch um andere Rollen und Positionen kann es Konflikte geben, gleich ob es um die des "Gescheiten", die des Spaßmachers, des "ruhenden Pols" oder um die des "Antreibers" geht. Doch vom Grundsatz her kann für alle Mitglieder eines Teams erreicht werden, dass jedes einen Platz findet, mit dem es zufrieden ist oder doch zumindest leben kann. |
|
|
Bis es jedoch soweit ist, ist ein Stück Sortierarbeit zu leisten. Deshalb braucht jede neue Gruppe eine gewisse Zeit, bis sie, wie man sagt, "sich gefunden hat" – das heißt, bis die Rollen und Positionen so verteilt und geordnet sind, dass alle mit ihrem Platz einverstanden sind. In dieser Findungsphase geht es nicht nur um Zugehörigkeit, sondern auch um Geltung und Status. Aus diesem Grund kommt auch in jede Gruppe und jedes Team erst einmal eine gewisse Unruhe, wenn neue Mitglieder hinzustoßen oder bisherige ausscheiden: Dann geht die Rollenklärung zwar nicht von vorne los, aber sie muss zumindest an den Stellen neu geordnet werden, wo es plötzlich Konkurrenz um Positionen gibt, sowie dort, wo Lücken entstanden sind, weil eine wichtige Rolle nicht mehr besetzt ist. |
||
|
Am ehesten gelingt es, ein Teamklima zu schaffen, in dem jeder seine akzeptierte Rolle und Position hat, wenn die Gruppe in einem Geist geführt wird, den der Adler-Schüler Rudolf Dreikurs (1897 – 1972) als "soziale Gleichwertigkeit" bezeichnet hat. Gleichwertigkeit ist weder gleichzusetzen mit Gleichheit noch mit Gleichberechtigung. Die Mitarbeiter in einem Unternehmen sind weder gleich – sie haben unterschiedliche Funktionen, Fähigkeiten und Gehälter – noch gleichberechtigt: Sie haben auch unterschiedliche Verantwortungsgebiete und Entscheidungsbefugnisse. Aber sie sind trotzdem gleichwertig in dem Sinne, dass keiner als Mensch wertvoller ist als die anderen, und dementsprechend auch keiner weniger wert ist. Jeder hat das Recht, mit Respekt und Achtung behandelt zu werden; jeder hat Mitverantwortung für den gemeinsamen Erfolg; niemand hat das Recht oder sollte das Recht haben, sich über andere zu stellen, sie abzuwerten oder sich als etwas Besseres zu fühlen. Das ist keineswegs nur eine moralische Forderung, es ist ebenso sehr eine praktische. Denn nur wenn ein Team vom Geist der Gleichwertigkeit geprägt ist, kann sich dort ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln, in dem alle Teammitglieder ihren bestmöglichen Beitrag zum Team- oder Unternehmenserfolg leisten können und wollen. |
|
|
|
Die klassische Individualpsychologie hat zwar das Konfliktpotenzial erkannt, das sich aus dem Geltungsstreben und daraus resultierenden Konkurrenzsituationen ergibt, sie neigte jedoch dazu, dieses Streben nach Macht und Geltung als Ausfluss von Minderwertigkeitsgefühlen und deren Überkompensation anzusehen. Dass nicht nur das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, sondern auch das Streben nach einem guten Platz in der Gruppe zur Natur des Menschen gehört, ist denn auch weniger ein individualpsychologisches Argument denn ein soziobiologisches: Welche Rangposition ein Mensch in seinem sozialen System einnimmt, dürfte zumindest in früheren Jahrtausenden erheblichen Einfluss auf seine Chancen gehabt haben, seinen Nachwuchs durchzubringen. Also sollten im Laufe der Zeit die Gene an Verbreitung gewonnen haben, die ihre Träger dazu brachten, sich so zu verhalten, dass sie einen guten Platz in ihrer Gruppe einnahmen. |
|
|
Wenn das richtig ist, ist es auch für die Theorie der Individualpsychologie von Bedeutung. Denn es heißt, dass die Anstrengungen, die Menschen unternehmen, um sich in einer Gruppe zu profilieren und zu positionieren, keineswegs nur Ausdruck eines ungesunden "Geltungsstrebens" sind, sondern ein – wenigstens vom Grundsatz her – gesundes Bemühen darum, sich einen guten und anerkannten Platz in dieser Gruppe zu erobern. Nicht das Streben nach einem anerkannten Platz selbst wäre dann Ausdruck von Minderwertigkeitsgefühlen, es wäre allenfalls die Art, wie ein Mensch dieses Ziel verfolgt. Eine Selbstdarstellung beispielsweise, die realistisch-positiv ist, den eigenen Beitrag zum Erfolg der Gruppe herausstellt und von Respekt für die anderen Teammitglieder geprägt ist, wäre dann kaum als unangemessen zu bezeichnen. Profilierungsversuche hingegen, die das eigene Ansehen dadurch zu erhöhen suchen, dass sie andere Teammitglieder herabsetzen, den eigenen Beitrag zu Erfolgen maßlos übertreiben oder unhaltbare Versprechungen machen, können tatsächlich Ausdruck von Minderwertigkeitsgefühlen sein, weil darin indirekt die Überzeugung der Betreffenden zum Ausdruck kommt, mit dem, was sie realisitischerweise zu bieten haben, nicht "gut genug" zu sein. Der richtige Maßstab wäre dann zum einen die Angemessenheit und Sachgerechtigkeit der Profilierung, zum anderen und noch wichtiger, ob sie prosozial oder antisozial ist, also zum Gemeinschaftsgefühl der Gruppe beiträgt oder es schwächt. Eine wichtige Führungsaufgabe wäre in diesem Fall, diesem Bedürfnis nach Ansehen und Geltung Raum zu geben, es aber in förderliche Bahnen zu lenken und zu verhindern, dass es Formen annimmt, die andere Teilnehmer entwerten oder dem Teamgeist auf andere Weise schaden. |
|
|
Im beruflichen Umfeld ist die Frage nach der eigenen Position und dem eigenen Ansehen sigar noch wichtiger, weil dort die Zugehörigkeit keine bedingungslose ist, wie in der Familie, sondern nur eine bedingte. Im Gegensatz zu Familie, Clan und Nation sind Unternehmen ja keine Lebensgemeinschaft, in die man hineingeboren wird und dann zeitlebens angehört, sondern zeitlich befristete Zweckgemeinschaften, in denen Arbeitsleistung gegen Vergütung getauscht wird. Die Zugehörigkeit ist hier, wenigstens vom Prinzip her, an die Bedingung geknüpft, dass für beide Seiten das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung stimmt: Unternehmen können sich von Mitarbeitern trennen, mit deren Leistung sie nicht zufrieden sind, und Mitarbeiter können sich einen anderen Job suchen, wenn sie woanders mehr Geld bekommen, bessere Arbeitsbedingungen oder auch eine reizvollere Aufgabe finden. Dazu kommt, dass unterschiedliche Positionen recht unterschiedlich vergütet sind. Es liegt daher auf der Hand, dass Menschen sich unter solchen Bedingungen nicht nur zugehörig fühlen, sondern eine möglichst gute Position einnehmen wollen. |
|
|
Weshalb sich Menschen völlig unterschiedlich verhalten |
||
Dass wir Menschen soziale Wesen sind, spiegelt sich auch in den Motiven unseres Handelns wider: Sie haben in aller Regel einen sozialen Bezug. Sehr häufig ist unser Handeln eine Reaktion auf die soziale Situation, in der wir uns befinden, und zugleich eine Stellungnahme dazu, und ein Versuch, die Situation in unserem Sinne zu beeinflussen. Im Gegensatz zu den meisten psychologischen Schulen und Theorien erklärt die Individualpsychologie menschliches Handeln nicht kausal ("Er hat das getan, weil …"), sondern final ("Er hat das getan, um zu …"). Weil sie den Menschen als ein zielgerichtet handelndes, Entscheidungen treffendes Wesen sieht, interessiert sie nicht so sehr für die Ursachen des Handelns, sondern für dessen Sinn und Zweck. Deshalb fragt die Individualpsychologie nicht etwa, warum sich jemand ein einer bestimmten Weise verhalten hat, sondern zu welchem Zweck: Welche Absichten und Ziele verfolgte er damit? |
||
Diese veränderte Blickrichtung hat erhebliche Auswirkungen sowohl für die psychologische Theoriebildung als auch für das Menschenbild: Die Frage nach dem "Warum" führt in die Vergangenheit; man sucht die Ursachen des heutigen Verhaltens dann beispielsweise in frühkindlichen Prägungen oder traumatischen Ereignissen und verliert sich dabei leicht in Spekulationen. Diese Betrachtungsweise macht den Mensch zum Objekt, das hauptsächlich von seiner Vorgeschichte bestimmt ist und kaum anders handeln kann als es seiner biographischen Prägung entspricht. Ähnlich vergangenheitsbestimmt und reaktiv sehen den Menschen übrigens auch der klassische Behaviorismus mit seiner Hervorhebung der Lerngeschichte und die ältere Verhaltensforschung mit ihrer Betonung der Prägungen. Die individualpsychologische Frage nach dem "Wozu" hingegen begreift den Menschen als aktiv handelndes, zukunftsorientiertes Wesen, das in jeder Situation seine Entscheidungen trifft und vom Grundsatz her immer auch die Möglichkeit hat, sich anders zu entscheiden. Sie bestreitet nicht, dass die Lebensgeschichte für das heutige Verhalten eine Rolle spielt, aber nicht so sehr wegen der Erfahrungen, die wir gemacht haben, sondern wegen der Schlussfolgerungen, die wir daraus für unser Handeln gezogen haben. Das ist ein fundamentaler Unterschied, denn während man die Erfahrungen nicht ändern kann, kann man die gezogenen Schlussfolgerungen und die daraus abgeleiteten Ziele ändern – und damit auch seine Stellungnahme zu den Herausforderungen des Lebens. |
||
Aber wie findet man heraus, welche Ziele und welche Absicht jemand mit seinem Handeln verfolgt? In erster Annäherung dadurch, dass man beobachtet, welche Folgen sein Handeln hat. Eine bewährte Arbeitshypothese lautet: Das, was jemand bewirkt hat, war, was er bezweckt hat. Das mag auf den ersten Blick nach einem allzu schnellen Sch(l)uss klingen: Kann es nicht auch vorkommen, dass wir mit unserem Handeln keineswegs das erreichen, was wir erreichen wollten, sondern dass etwas ganz anderes herauskommt? Doch, das kann passieren, etwa wenn uns eine Situation "aus dem Ruder läuft" und sich ganz anders entwickelt als wir es beabsichtigt hatten. Aber das ist eher die Ausnahme als der Normalfall; so etwas passiert uns eigentlich nur auf Neuland, also in Situationen, mit denen wir nicht ausreichend vertraut sind. Solche unerwünschten Folgen erkennt man in der Praxis ganz leicht daran, dass die betreffenden Personen sofort versuchen, die eingetretene Entwicklung zu korrigieren, zum Beispiel durch zusätzliche Signale. Wenn wir etwa bemerken, dass wir jemanden mit einer Aussage unbeabsichtigt gekränkt haben, sagen wir in der Regel sofort etwas, um den Betreffenden zu beschwichtigen und um die ungewollte Wirkung unserer Aussage zu beseitigen oder abzuschwächen. Was im Umkehrschluss heißt: Wenn wir in einer solchen Situation nichts sagen, dann war die kränkende Wirkung wohl beabsichtigt. In den meisten Situationen des privaten wie des beruflichen Alltags können wir die Wirkungen unseres Handelns ziemlich gut abschätzen. Es wäre daher völlig unplausibel anzunehmen, dass wir oft etwas ganz anderes bewirken als wir beabsichtigt hatten. Denn Menschen sind ja am Erfolg ihres Handelns interessiert, also handeln sie nach besten Kräften so, dass sie ihre Ziele erreichen. Dazu wählen sie in jeder Situation aus ihrem Handlungsrepertoire diejenige Verhaltensstrategie aus, von der sie nach ihren bisherigen Erfahrungen erwarten, dass sie ihre Ziele erreichen werden. |
||
Hier trifft sich die Individualpsychologie mit der psychologischen Lerntheorie, die besagt: Verhaltensweisen, die in der Vergangenheit erwüsnchte Konsequenzen hatten – wie etwa, uns unseren Zielen näherzubringen –, behalten wir bei und bauen sie aus; Verhaltensweisen, die unerwünschte Konsequenzen hatten, geben wir auf; stattdessen probieren wir beim nächsten Mal etwas anderes. Das heißt im Umkehrschluss: Stabiles Verhalten ist also aus subjektiver Sicht erfolgreiches Verhalten – anderenfalls würde es nicht beibehalten. |
||
Und wie kommt es dann, dass Menschen manchmal auf eine Art und Weise handeln, die man schwerlich als erfolgreich bezeichnen kann? Das kann zwei Gründe haben: Der eine ist, wie bereits erwähnt, dass der Handelnde die Situation zu wenig verstehen, um gezielt und erfolgreich agieren zu können. Das gibt es, aber es ist eher selten, denn meist bewegen wir uns ja in einem Umfeld, dessen Regeln und Reaktionsmuster wir kennen. Weitaus häufiger und sehr viel wichtiger ist der andere Grund. Er ist, dass Menschen, die sich aus unserer Sicht völlig ungeeignet verhalten und daher aus unserer Sicht auch keine guten Ergebnisse erzielen, aus ihrer subjektiven Sicht oft durchaus erfolgreich waren. Die Lösung des scheinbaren Paradoxons liegt darin, dass die Betreffenden andere Ziele verfolgen als wir sie stillschweigend voraussetzen. Und wenn jemand andere Ziele hat als wir sie unterstellen, dann ist es nur logisch, dass er sich auch anders verhält "als wir es an seiner Stelle getan hätten". Der Fehler liegt also nicht darin, dass sich diese Menschen unsinnig verhalten hätten, sondern darin, dass wir unsere eigenen Ziele als Erfolgsmaßstab für ihr Handeln verwenden: So muss uns ihr Verhalten zwangsläufig oft unverständlich bleiben. |
||
Das Verhalten erschließt sich aus den Zielen |
||
Zu den häufigsten Fehlern der Alltagspsychologie zählt aber genau dies: Wir gehen stillschweigend davon aus, dass andere Menschen die gleichen Ziele verfolgen wie wir – und wundern uns dann, warum sie sich so "merkwürdig" (ungeschickt, seltsam, unüberlegt, irrational …) verhalten. Aber das ist natürlich naiv, denn wieso sollten andere Menschen ihr Handeln an unseren Zielen ausrichten? Andere Menschen haben selbstverständlich ihre eigenen Ziele, und die weichen in aller Regel von den unseren ab – manchmal nur geringfügig, manchmal aber auch von Grund auf. Also ist es nur logisch, dass sie dann auch anders handeln. Ein Mensch, dessen größte Sorge es ist, sich zu blamieren, verhält sich logischerweise anders als einer, dessen höchstes Ziel ist, andere zu beeindrucken und allgemeine Bewunderung auf sich zu ziehen. Jemand, dessen Menschenbild von Optimismus und Vertrauen geprägt ist, verfolgt im Umgang mit Menschen logischerweise andere Ziele als einer, der zutiefst davon überzeugt ist, dass alle Menschen nur auf ihren eigenen Vorteil aus sind und er daher ständig auf der Hut sein muss. |
||
Zwar wollen alle Menschen erfolgreich sein und verhalten sich so, dass sie es nach Möglichkeit sind – aber sie haben völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, was "Erfolg" bedeutet. Für einen misstrauischen Menschen bedeutet Erfolg, nicht betrogen worden zu sein, für einen optimistischen mag es bedeuten, neue Chancen zu entdecken. Für einen ängstlichen Menschen heißt es, den überall lauernden Gefahren erfolgreich ausgewichen zu sein, für einen ehrgeizigen, Neid und Bewunderung auf sich gezogen zu haben. Erfolgreich handeln sie alle – nur gemessen an sehr unterschiedlichen Zielen und Erfolgsmaßstäben. Welche Ziele andere in ihrer Umgebung für anstrebenswert hält, ist dabei von nachgeordneter Bedeutung. Es spielt eine gewisse Rolle, weil es einen gewissen Erwartungsdruck auslösen kann; trotzdem orientiert sich das Verhalten am Ende in erster Linie an den eigenen Zielen – freilich einschließlich derer, die sich ein Mensch als soziale Normen zu eigen gemacht hat. |
|
|
Wenn sich die Ziele eines Menschen ändern, ändert sich auch sein Verhalten. Wie großen Einfluss die Ziele haben, wird im beruflichen Bereich besonders gut sichtbar: Wenn jemand etwa durch beruflichen Aufstieg die Rolle wechselt, ändern sich auch seine Ziele. Nehmen wir einen Vertriebsmitarbeiter, der bei den jährlichen Zielvereinbarungsrunden bislang immer der Wortführer derjenigen war, die die Zielvorstellungen des Unternehmens als völlig unrealistisch und überzogen bekämpften. Wird er nun in eine Führungsposition befördert, sagt er bei der jährlichen Zielrunde zum Erstaunen seiner Kollegen plötzlich Dinge, die ihm früher nie über die Lippen gekommen wären. Das regt auch niemanden ernsthaft auf, selbst sein plötzlicher "Meinungswandel" führt nur vorübergehend zu spöttischen Bemerkungen, denn allen ist klar: Er hat jetzt einen anderen Hut auf. Das setzt sich fort: Ist sein wichtigstes Ziel als frischgebackene Führungskraft vielleicht noch, alles unter Kontrolle zu behalten und keine Fehler zu machen, ändern sich seine persönlichen Ziele, wenn er selbst sicherer geworden ist und sich darum bemüht, in seinem Team die Motivation hoch zu halten: Dann gibt er seinen Mitarbeitern mehr Freiräume. |
||
Dass menschliches Handeln fast immer ein im Sinne der eigenen Ziele erfolgreiches Handeln ist, heißt freilich nicht, dass wir immer über sämtliche Folgen unseres Handelns begeistert sind. Manchmal gibt es auch Zielkonflikte – etwa, wenn ein junger Mann ein Mädchen gerne kennenlernen würde, aber Angst vor einer Abfuhr hat. Sich entscheiden, heißt immer auch, mögliche negative Folgen des eigenen Handelns oder Unterlassens in Kauf zu nehmen. Wenn er zögert und die Gelegenheit schließlich verstreichen lässt, heißt das nicht, dass er das Mädchen in Wahrheit gar nicht kennenlernen wollte – es heißt lediglich, dass ihm das Vermeiden des Risikos einer Abfuhr unter dem Strich wichtiger war als die Chance zum Kontakt. Gut möglich, dass er das Resultat durchaus unglücklich ist. Dennoch führt kein Weg daran vorbei, dass er sich selbst so entschieden hat. Nicht seine Angst hat ihn gehemmt; er selbst hat in Kenntnis der möglichen Folgen einer Kontaktaufnahme die risikoärmere Alternative gewählt. Und nicht seine tiefsten Wünsche, sondern sein Handeln (bzw. Unterlassen) zeigen, wie er sich real entschieden hat. |
||
Auch bei vielen anderen Gelegenheiten nehmen wir die Risiken und Nebenwirkungen unserer eigenen Entscheidungen in Kauf – zuweilen missbilligend, aber dennoch: Ein Mensch, dessen größte Sorge es ist, von anderen Menschen ausgenützt und betrogen zu werden, wird sich vermutlich so verhalten, dass er mit seinem Misstrauen viele Menschen verprellt. Dass der damit auch Chancen verspielt, wird er vermutlich bestätigen, wahrscheinlich sogar mit Bedauern. Aber nach seiner Überzeugung "gibt es halt leider nur sehr wenige Menschen, denen man wirklich vertrauen kann". Deshalb handelt er aus seiner Sicht richtig. Dass er sich aus Sicht von Beobachtern, die ein freundlicheres Menschenbild haben, völlig ungeeignet, ja geradezu irrational verhält, wird ihn wenig beeindrucken. Aus seiner subjektiven Sicht verhält er sich absolut sinnvoll und höchst erfolgreich, schließlich erreicht er auf diese Weise, dass ihn kaum jemand übervorteilen kann. Und das ist offenkundig sein oberstes Ziel, aus dem heraus er sein Tun und Unterlassen begründet. Die Individualpsychologie nennt das die "private Logik". |
||
Tendenziöse Wahrnehmung |
||
Aber Menschen verfolgen nicht nur unterschiedliche Ziele, sie nehmen die Realität auch unterschiedlich wahr. Es kann durchaus sein, dass andere Menschen die gleiche Situation völlig anders erleben als wir: als bedrohlicher oder als harmloser, als bedeutsamer oder als unwichtiger, als anregender oder langweiliger. Ein mittelgroßer Hund, der auf der Straße auf sie zuläuft, löst bei manchen Menschen freudige Erregung aus, bei anderen Desinteresse und bei wieder anderen Panik. Logisch also, dass sie auch völlig unterschiedlich reagieren. Wann immer wir uns das Handeln eines Menschen unverständlich ist, wenn es uns unsinnig oder gar irrational erscheint, haben wir in Wirklichkeit entweder seine Ziele oder auch seine Wahrnehmung der Realität nicht verstanden. Oder beides. Vermutlich machen wir dabei genau den gerade beschriebenen Fehler: Wir messen wir sein Handeln, ohne es zu merken, an unseren Zielen und unserer Wahrnehmung der Realität. Und vor diesem Hintergrund ergibt es natürlich keinen Sinn. Wie sollte es auch?! |
|
|
Wie leicht wir auf die Denkfalle hereinfallen, anderen unsere Wahrnehmung und unsere Ziele stillschweigend zu unterstellen, zeigt sich zum Beispiel bei der Ankündigung von Veränderungen: Wenn die Mitarbeiter darauf aufgeregt und ängstlich reagieren, trifft dies beim Management nicht selten auf Unverständnis. Sie finden, dass es "objektiv" keinerlei Grund zur Beunruhigung gibt, und ärgern sich, dass die Mitarbeiter "immer nur nach dem Haar in der Suppe suchen" und den positiven Perspektiven ihres Vorhabens keinerlei Beachtung schenken. In dieser Mischung aus Enttäuschung und Empörung sind die oberen Ebenen kaum bereit und in der Lage, sich ernsthaft mit der Realitätswahrnehmung und den Zielen der Mitarbeiter auseinanderzusetzen; sie versuchen allenfalls, sie mit beschwichtigenden Worten und der Hervorhebung positiver Aspekte der Veränderung zu zerstreuen. Aber das nützt natürlich nichts, weil es an der Wahrnehmung der Mitarbeiter und ihren Befürchtungen vorbeigeht. Solange das Management seine Sicht der Dinge als die einzig richtige und einzig mögliche betrachtet und sich nicht auf die Sichtweise der Mitarbeiter einlässt, ist keine Verständigung möglich; die Hierarchieebenen reden aneinander vorbei. |
||
Zwischen unseren Zielen und unserer Wahrnehmung der Realität besteht eine Wechselbeziehung: Wie wir eine gegebene Situation wahrnehmen, hat großen Einfluss darauf, für welche Ziele wir uns entscheiden. Wer sein Gegenüber als arrogant und bedrohlich wahrnimmt, wird im Kontakt mit ihm andere Ziele anstreben als jemand, der die gleiche Person als unsicher und defensiv erlebt. Umgekehrt beeinflussen unsere Ziele, wie wir die Realität wahrnehmen: Wer ängstlich ist und daher in erster Linie Risiken vermeiden möchte, nimmt die Welt anders wahr und verfolgt andere Ziele als jemand, der mutig ist und nach neuen Herausforderungen sucht. Die moderne Sozialpsychologie spricht hier von "selektiver Wahrnehmung", die Individualpsychologie bezeichnet den Vorgang präziser als tendenziöse Wahrnehmung. Sie sagt damit, dass es kein Zufall ist, auf welche Aspekte der Welt und unserer Mitmenschen wir unsere Aufmerksamkeit fokussieren, sondern dass dies Ausdruck unserer privaten Logik und unseres Lebensstils ist. |
||
Verstehen und Verständnislosigkeit, Akzeptanz und Entwertung |
||
Die Ziele und die dahinter stehende Realitätswahrnehmung eines Menschen kann man aus seinem Verhalten erschließen. Man muss dafür nur die Annahme machen, dass jeder Mensch sich aus seiner subjektiven Sicht sinnvoll verhält. Dann lautet die Schlüsselfrage zur Erklärung seines Verhaltens ganz schlicht: Wie müsste dieser Mensch die Realität wahrnehmen und welche Ziele müsste er verfolgen, damit sein Handeln sinnvoll und logisch wird?
|
||
Das ist am Anfang eine ungewohnte und etwas anstrengende Perspektive, aber sie trägt erstaunlich weit, wenn es darum geht, die innere Logik eines scheinbar unverständlichen Verhalten zu entschlüsseln: Sobald wir die Ziele und die dahinter stehende Realitätswahrnehmung eines Menschen verstanden haben, können wir sein Handeln in kritischen Situationen recht gut vorhersagen. Die Qualität unserer Vorhersagen wiederum ist der alleinige Maßstab dafür, ob wir einen Menschen wirklich verstanden haben oder ob wir uns das bloß einbilden. |
||
Allerdings kann es passieren, dass wir beim Versuch, die innere Logik des Verhaltens eines anderen Menschen zu verstehen bzw. nachzuempfinden, an die Grenzen unserer Empathie stoßen. Das zeigt sich meist darin, dass wir bei allem Bemühen keinen Zugang zur subjektiven Logik der betreffenden Person finden – oder aber, dass wir überhaupt keine Lust haben (sprich, nicht bereit sind), uns in seine Wahrnehmung und seine Ziele hineinzuversetzen. So etwas ist im Normalfall nicht tragisch und sagt weder etwas Negatives über den einen noch über den anderen aus; es bewirkt lediglich, dass unsere momentanen Möglichkeiten, den anderen zu verstehen, stark eingeschränkt sind. Infolgedessen ist die Verständigung und Zusammenarbeit schwieriger als bei Menschen, mit denen wir uns (aufgrund ähnlicher Realitätswahrnehmung und Ziele) beinahe blind verstehen. |
||
Andererseits muss man sich nicht perfekt verstehen, um brauchbar zusammenzuarbeiten zu können; es ist sogar die Frage, ob ein vollständiges Verstehen überhaupt erreichbar und anstrebenswert ist. Ein Stück "fremde Welt" bleibt vermutlich nicht nur im Bezug auf andere Menschen, sondern auch auf uns selbst, und das darf auch so sein. Statt vollständig zu verstehen, genügt es im Alltag meistens schon, zu akzeptieren und zu respektieren, was dem anderen wichtig ist. Beispielsweise müssen wir nicht unbedingt den lebensgeschichtlichen Hintergrund dafür verstehen, weshalb ein Kollege keine Überraschungen liebt und größten Wert auf Planbarkeit und Berechenbarkeit legt. Für eine gute Zusammenarbeit genügt es, zur Kenntnis zu nehmen, dass es so ist, und es nach Möglichkeit zu berücksichtigen. |
||
Das klingt simpel, aber in der Realität geschieht oft das genaue Gegenteil: Wir neigen dazu, Verhaltensweisen und Bedürfnisse, die wir nicht verstehen, vorschnell zu be- und zu verurteilen. Beispielsweise fällt es selbstbewussten Managern oft schwer, sich bei scheinbar harmlosen Veränderungen der Arbeitsorganisation in die Ängste und Nöte mancher langjähriger Mitarbeiter hineinzuversetzen. Manche reagieren regelrecht wütend, dass die Leute sich so anstellen, obwohl keine Arbeitsplätze zur Disposition stehen, sondern lediglich einige "lächerliche Prozessveränderungen" vorgenommen werden. Es gelingt ihnen kaum, sich in die Ängste älterer Mitarbeiter hineinzudenken, die sich veränderten Anforderungen nicht mehr gewachsen fühlen. Das wäre nicht einmal tragisch, wenn es nicht dazu führte, dass sie diese Ängste oft allzu schnell und allzu barsch vom Tisch wischten. Selbst wenn sie diese Ängste nicht nachvollziehen können oder wollen, würde es helfen, deren Existenz zur Kenntnis zu nehmen. Denn die Missachtung dieser "Befindlichkeiten" heizt die Widerstände erst an, die dann aufwändig "gemanagt" werden müssen, und provoziert das Risiko eines destruktiven Machtkampfs. |
||
Persönlichkeit, Lebensstil und private Logik |
||
Als "Lebensstil" bezeichnet die Individualpsychologie das, was andere psychologische Schulen die "Persönlichkeit" oder den "Charakter" nennen. Die Begriffe liegen eng beieinander, unterscheiden sich aber in einer charakteristischen Nuance: Während Persönlichkeit "geformt wird" und Charakter nach "angeboren" klingt, betont der Begriff "Lebensstil" auch hier wieder das aktiv handelnde und entscheidende Element. Wie die meisten psychologischen Schulen, so geht auch die Individualpsychologie davon aus, dass sich unsere Persönlichkeit in den ersten Lebensjahren herausbildet. Als maßgeblich betrachtet sie aber nicht Prägungen oder traumatische Ereignisse, sondern die Stellungnahme des Kindes zu dem, was ihm in seinen frühen Jahren widerfährt. Aus individualpsychologischer Perspektive ist nicht so entscheidend, welche Lebenserfahrungen wir objektiv gemacht haben, sondern welche Schlussfolgerungen wir daraus abgeleitet haben. Und vor allem, wie wir auf dieser Basis mit unseren heutigen Lebensaufgaben umgehen. |
|
|
Natürlich spielt auch das soziale Umfeld für die Persönlichkeitsentwicklung eine wichtige Rolle: das Familienklima, der eigene Platz in der Geschwisterkonstellation und die soziokulturellen Rahmenbedingungen. Jede Lebenssituation konfrontiert schon kleine Kinder mit ganz spezifischen Herausforderungen: Wer als zweites oder drittes Kind geboren wurde, macht die Erfahrung, dass der Platz des Ältesten schon besetzt ist, und steht nun vor der Aufgabe, sich von ihm abzuheben und seine Rolle zu finden – das älteste Marketing-Problem der Menschheitsgeschichte. Trotzdem entwickeln sich nicht alle zweit- und drittgeborenen Kinder gleich – entscheidend ist, wie sie zu ihrer Herausforderung Stellung nehmen: Ob sie mutig ihren eigenen Weg gehen, ob sie mit den Älteren in Konkurrenz treten oder ob sie sich von dessen Überlegenheit entmutigen lassen und resignieren. Älteste wiederum machen – im Gegensatz zu Einzelkindern – früh die Erfahrung, dass es nachdrängende "Konkurrenz" gibt, gegen die sie sich behaupten müssen. Was ihnen je nach Altersabstand, Talenten und gewählten Strategien unterschiedlich gut gelingt. Die Individualpsychologie liefert so eine äußerst schlüssige Erklärung für ein Paradoxon, über das sich viele Menschen wundern: Wie es denn sein kann, dass Kinder so unterschiedlich sind, obwohl sie doch Geschwister sind. Die individualpsychologische Lösung dieses Rätsels lautet: Sie sind so unterschiedlich, gerade weil sie Geschwister sind. |
||
Jeder Mensch entwickelt in diesen frühen Lebensjahren seine Sicht, wie die Welt ist und wie die anderen Menschen sind. Er leitet daraus ab, was er tun und wie es sich verhalten muss, damit die eigenen Bedürfnisse erfüllt werden. Das heißt, er entwickelt seinen Lebensstil, seine persönliche Art, die Welt zu sehen, und seine Strategie, mit dem Leben zurechtzukommen. Diese frühen Weichenstellungen sind nicht deshalb so wichtig, weil sie unwiderruflich wären, sondern weil unser ganzer weiterer Lebensweg darauf aufbaut. Der Individualpsychologe Theo Schoenaker hat das in eine schöne Metapher gefasst: Das Leben ist wie ein großes Schloss. Schon in der Eingangshalle haben wir unterschiedliche Türen zur Auswahl, und je nachdem, für welche wir uns entscheiden, kommen wir in unterschiedliche Räume und haben dort wieder unterschiedliche Türen zur Auswahl. Je nach dem Weg, den wir einschlagen, gelangen wir im Laufe der Zeit in ganz unterschiedliche Trakte und machen uns unterwegs unser Bild, wie das Gebäude ist: ob es ein schönes oder ein hässliches, ein bedeutendes oder ein belangloses, ein sicheres oder gefährliches Gebäude ist. Auf Basis dieser Erkenntnisse setzen wir unseren Weg fort. Jeder weitere Raum, den wir auf diese Weise betreten, verfeinert und ergänzt das Bild, verändert es aber in der Regel nicht mehr grundlegend. Meist bestätigen die neuen Erfahrungen nur noch, was wir längst wussten: So ist das Leben. Jemand, der auf seinem Weg durch das Gebäude andere Türen gewählt hat, befindet sich vielleicht in einem Trakt, der völlig anders aussieht. Doch er weiß mit der gleichen Gewissheit: So ist das Leben. Es kann daran überhaupt keinen Zweifel geben, er erfährt und erlebt es ja jeden Tag aufs Neue – in seinem Gebäudetrakt. |
|
|
Schon als Schulkind haben wir auf diese Weise unseren Lebensstil weitgehend herausgebildet. Bevor wir zehn Jahre alt geworden sind, haben wir schon viele Erfahrungen gemacht. Und wir haben daraus unsere Schlussfolgerungen gezogen, wie das Leben ist und wie wir uns darin bewegen müssen. Die bis dahin eingeschlagene "Lebenslinie" oder, wie Adler einmal formuliert hat, die Grundmelodie ihres Lebensstils, behalten die meisten Menschen ihr ganzes Leben bei – schon weil sie sich gar nicht vorstellen könnten, dass die Welt und die Mitmenschen auch anders sein könnten als es ihren Erfahrungen entspricht. Dabei verkennen wir in der Regel, dass unsere Erfahrungen nicht unabhängig von unserem Denken, Fühlen und Handeln sind, sondern sozusagen unser eigenes soziales Echo. Ohne uns dessen bewusst zu sein, "machen" wir unsere Erfahrungen – im aktiven Sinne des Wortes. Und jede neue dieser selbstgemachten Erfahrungen bestätigt uns, dass unser Welt- und Menschenbild richtig ist: Sie untermauert unsere private Logik. |
||
Individualpsychologie und Change Management |
||
Was bringt die Individualpsychologie für das Change Management? Zunächst einmal eine neue Perspektive, das Verhalten von Mitarbeitern, Führungskräften und ganzen Organisationseinheiten zu betrachten, und damit einen neuen Ansatz, dessen Gründe, oder genauer, seinen Sinn und seine Ziele zu verstehen. Wenn wir annehmen oder auch nur als Arbeitshypothese akzeptieren, dass dieses Verhalten aus subjektiver Sicht sinnvoll und zielgerichtet ist, können wir aus dem Verhalten aus dessen Ziele und auf die dahinter stehende Wahrnehmung der Realität zurückschließen. Dann können wir zum Beispiel aus defensiven Reaktionen von Mitarbeitern und Betriebsrat schließen, dass für sie bei dem aktuellen Veränderungsvorhaben die Bedrohlichkeit überwiegt und sie daher keinen Blick für dessen Chancen und Potenziale haben. Auf der Basis eines besseren Verständnisses der Ziele und Motive können wir sehr viel gezielter und wirksamer handeln. Das beginnt damit zu erkennen, dass es keinen Sinn hat, die Realitätswahrnehmung der Mitarbeiter für ungültig zu erklären und mit der eigenen Wahrheit dagegen anzurennen. Zu erkennen, dass wir an der subjektiven Realität der Mitarbeiter ansetzen müssen, wenn wir sie erreichen wollen, und dass wir auf dieser Basis einen gleichwertigen Dialog führen müssen, um Akzeptanz für die notwendigen Veränderungen zu gewinnen. Ein möglicher Weg, dies zu realisieren, ist die gemeinsame Erarbeitung von Bewahrungs-, Veränderungs- und Vermeidungszielen. |
||
Besonders wichtig ist der individualpsychologische Denkansatz für die Themen Unternehmenskultur und Kulturveränderung. Wenn das Top-Management der Meinung ist, dass sich das Verhalten der Mitarbeiter und Führungskräfte ändern muss, dann lautet die erste Frage, weshalb die sich heute eigentlich anders verhalten als es aus Sicht des Top-Managements notwendig wäre. Es hat wenig Sinn, an der Kultur herumzuschrauben, bevor man die Gründe für das heutige Verhalten und deren innere Logik verstanden hat. Unerwünschtes Verhalten mit Dummheit, Bequemlichkeit oder versteckter Bosheit zu erklären, bringt herzlich wenig; es verleitet allenfalls zu zum Versuch, Verhaltensänderungen zu erzwingen, und dem entsprechenden aktivem und passiven Widerstand. Sehr viel fruchtbarer ist, als Leithypothese für die Kulturanalyse davon auszugehen, dass das Handeln der Mitarbeiter und Führungskräfte, auch wenn es aus Unternehmenssicht nachteilig und unerwünscht ist, aus deren subjektiver Sicht sinnvoll und zielführend ist. Die Frage aller Fragen lautet dann: Wie kann es sein, dass ein für das Unternehmen nachteiliges Verhalten für die Mitarbeiter bzw. Führungskräfte subjektiv sinnvoll ist? Welchen Nutzen, welche Vorteile hat dieses Verhalten für sie, welche Nachteile hätte es, sich anders zu verhalten? Diese Gründe, das heißt die innere Logik ihres heutigen Verhaltens, gilt es zu verstehen, um wirksame Strategien zur Kulturveränderung entwickeln zu können. Denn solange sich an diesen Gründen nichts ändert, wird sich auch an ihrem Verhalten nichts ändern. |
||
Auch für das Vorgehen zur Kulturveränderung liefert die Individualpsychologie die gedankliche Logik. Die alles entscheidende Frage lautet hier: Was müsste sich ändern, damit es für die betroffenen Mitarbeiter und Führungskräfte subjektiv sinnvoll wird, sich in der gewünschten Weise zu verhalten? Welche Vorteile des heutigen Verhaltens können ohne schädliche Nebenwirkungen beseitigt oder abgeschwächt werden, welche positiven Gründe für das angestrebte Verhalten können neu geschaffen oder verstärkt werden? Wenn es gelingt, die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass ein anderes Verhalten subjektiv sinnvoll wird, wird eine Kulturveränderung relativ schnell in Gang kommen. Wenn nicht, ist es äußerst unwahrscheinlich, ob sie jemals zustande kommt. |
|
|
Zugehörigkeit, Gleichwertigkeit und Ermutigung im Change Management |
||
Auch für die Gestaltung anderer Veränderungsprozesse bietet die Individualpsychologie zahlreiche wertvolle Anregungen, vor allem wegen ihres konsequenten Fokus' auf der Bedeutung der sozialen Beziehungen. Gedanken wie Zugehörigkeit, Ermutigung und soziale Gleichwertigkeit können und sollten als elementare Prinzipien für das Change Management verstanden werden. Viele Widerstände und Konflikte resultieren nicht so sehr aus den Zielen des jeweiligen Veränderungsvorhabens als aus der Art, wie es angegangen wird. Allzu häufig wird zum Beispiel die Bedeutung des Zugehörigkeitsgefühls und das Bedürfnis nach einer respektvollen, gleichwertigen Behandlung missachtet, etwa weil durch die Art des gewählten Vorgehens Teile der Belegschaft oder der Führungsmannschaft ausgegrenzt werden. Da sie sich dies nicht ohne Weiteres gefallen lassen, ist in solche Projekte ein destruktiver Beziehungskonflikt von vornherein fest eingebaut, und man muss sich nicht wundern, wenn die Betroffenen mit ihren Mitteln und Möglichkeiten – und das heißt in der Praxis vor allem: mit passivem Widerstand – zur Wehr setzen. Infolgedessen verheddern sich solche Veränderungsprojekte allzuoft in Machtkämpfen – und nicht wenige gehen darin unter. Wenn Projekte hingegen auf der Basis von Gleichwertigkeit konzipiert und angegangen werden, sind die Aussichten deutlich besser, sie zu einem positiven Ergebnis führen zu können. |
||
Von zentraler Bedeutung für das Change Management ist auch das individualpsychologische Konzept der Ermutigung. Viele Veränderungsprozesse sind in ihrer gesamten Struktur entmutigend angelegt – in aller Regel unbeabsichtigt, aber dennoch mit destruktiver Wirkung. Das beginnt mit dem Einsatz externer Berater, der in vielen Fällen – und meist zu Recht – als die Botschaft verstanden wird: Unsere Geschäftsleitung traut uns offensichtlich nicht zu, dieses Problem selbst lösen zu können. Vor allem in mittelständischen Unternehmen löst der Einsatz von Beratern oft ärgerliche und gekränkte Reaktionen aus; Großunternehmen reagieren hier mittlerweile abgestumpfter. Doch wie die Popularität von Beraterwitzen zeigt, schmerzt es auch dort, wenn Heerscharen von Beratern einfallen, die Internen zu Wasserträgern degradieren und schließlich Lösungen vorschlagen, mit denen die Internen mehrfach auf taube Ohren gestoßen sind. |
||
Zwar kann es durchaus sinnvoll sein, für bestimmte Aufgaben externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen, vor allem wenn die Berater eine Expertise mitbringen, die im Hause tatsächlich nicht in ausreichendem Maßes vorhanden ist. Doch wenn es sich dabei nicht um randständige Spezialthemen handelt, sondern um für das Geschäft wesentliche Fragen, sollte ein mutiges und ermutigendes Unternehmen seine besten Kräfte für die Zusammenarbeit mit den externen Beratern bereitstellen, um dieses Know-how zu erlernen und für das Unternehmen zu adaptieren. Dies muss sich auch in der Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Beratern widerspiegeln: Erstens sollte sie, damit sie nicht zur Verwöhnung wird, auf die Aufgaben beschränkt werden, für die tatsächlich externe Unterstützung benötigt wird. Und zweitens sollten solche Projekte, wie etwa in unserem Change Coaching-Ansatz, so angelegt werden, dass Interne und Externe darin auf gleicher Augenhöhe – also gleichwertig – zusammenarbeiten. Dann kosten sie nicht nur deutlich weniger Geld, sondern führen auch zu dem vielbeschworenen "organisationalen Lernen" und sind zugleich ein Instrument der Ermutigung für das ganze Unternehmen. |
||
Literatur: Dreikurs, Rudolf (1972): Soziale Gleichwertigkeit – die Forderung unserer Zeit Kornbichler, Thomas (2007): Die Individualpsychologie nach Alfred Adler Schoenaker, Theo (1991): Mut tut gut – Das Encouraging-Training Voland, Eckart (2000): Grundriss der Soziobiologie |
||
|
||
|
||
|